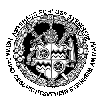Seite 6 von 8
Der Höhepunkt der antisemitischen Parteien im Kaiserreich war Ende des 19. Jahrhunderts überschritten. Nach der Jahrhundertwende war der Antisemitismus eine Angelegenheit im gesellschaftlichen Alltag von Vereinen und Berufsgruppen. Die Reichstagswahl
1912 wurde als „Judenwahl“ bezeichnet – eine Verschiebung „nach links“ wurde der öffent-
lichen Einflussnahme der jüdischen Wahlberechtigten zugeschrieben: 1911 gab es in allen jüdischen Zeitungen einen Wahlaufruf nach dem Motto: „Hauptsache gegen die Antisemiten!“ In der Mitte des Ersten Weltkriegs wurden in der Bevölkerung hetzende Zweifel laut, ob denn wirklich die Juden sich nicht vor dem Fronterlebnis drückten. Die Heeresleitung sah sich daraufhin zu einer „Judenzählung“ veranlasst, deren Ergebnisse allerdings nie veröffentlicht wurden.
Einmal von dem persönlich schmerzlichen Verlust seiner im Krieg gefallenen Söhne, ist es doch fortgesetzt ganz unwahrscheinlich, dass Ludwig Meyer-Gerngross den Schmerz und das Leid der antisemitischen Hetze nicht gespürt, nicht gesehen oder nicht erlitten haben sollte.
Er initiierte nach dem Ersten Weltkrieg eine Stiftung für die Bedürftigen in Steinheim, außerdem setzte er, genauso wie 1911, eine einmalige Summe aus. Fortgesetzt und konstant sollte Hilfe vor Ort geleistet werden können. Bis Ende der 20ziger Jahre gab er weitere zusätzliche Summen für den Stiftungszweck. Als er 1932 starb, beabsichtigte seine Witwe die Stiftungstätigkeit zunächst fortzusetzen.
Im Jahr 1940 wurde Helene Meyer-Gerngross, geborene Dinkelspiel, inzwischen 74-jährig in einem Eisenbahntransport mit 2333 anderen Mannheimerinnen und Mannheimern in das französische Lager Gurs deportiert. Die Überlebensbedingungen galten als sehr schlecht, täglich starben 6 Menschen. Helene Meyer-Gerngross verstarb im Lager Gurs noch im gleichen Jahr 1940.
Mit dem Tod der Ehefrau von Ludwig Meyer-Gerngross endet unserer Kenntnis nach das Leben des letzten unmittelbaren Familienmitgliedes. 1940 wurde auch sein gestiftetes Denkmal zerstört. Auf dem historischen Weg vom Friedensdenkmal zum Mahnmal mag die Bedeutung sich gewandelt haben, eine Intention des Stifters allerdings ist konserviert, sie erscheint den nachgeborenen Generationen unübersehbar aktuell: Die Hoffnung auf einen „inneren Frieden“ in der Gesellschaft bezüglich des Zusammenlebens untereinander kommt dem Denkmal von 1911 sehr nahe.
Die Kranzniederlegung findet nicht, wie im Aufsatz der drei Historiker zu lesen, und sie fand nie am 09.11. statt, sondern am 27.01. Der Datumsfehler mag noch einem Druckfehler gleichkommen. Eben nicht die Pogromnacht als Auftakt zum Holocaust wird zum Ausgangspunkt von Nachdenken, sondern auf den Tag der Befreiung des Lagers Auschwitz ist der Gedenktag gelegt (27.1.1945). Die Kranzniederlegung aber als „Brauch“ zu bezeichnen, ist mehr als problematisch. Sie trifft ins Mark des Verständnisses des Holocaustgedenkens selbst. Denn Brauchtum ist ein veralteter Begriff für eine ritualisierte und traditionelle Handlungsweise eines gesellschaftlichen Gemeinwesens. So „volkstümlich“ und mit entsprechend langer Tradition ist das Holocaustgedenken aber gerade nicht. Seit 1996 auf Proklamation des damaligen Bundespräsidenten ist es ein Anliegen, das von den politisch verfassten Gremien getragen wird – der Gedenktag wird in großen Städten und in Parlamenten begangen, 2005 wurde er internationaler Gedenktag durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Auch in der Art der Gestaltung ist es gerade kein „Brauch“, sondern nach wie vor Aufruf zum öffentlichen Denken über Dinge, die allzu leicht in Vergessenheit geraten, weil sie unangenehm waren und deshalb dem Schweigen vor allem aber auch der Fehlinterpretation ausgesetzt sind.