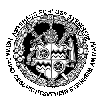27. Januar 2012 –
Nachdenken am Friedensdenkmal über das Friedensdenkmal
Thomas Kuchinke
Zum 100jährigen Bestehen des Friedensdenkmals im Oktober letzten Jahres konstatiert ein Vortrag von Herrn Dr. M. Maaser und ein Artikel in der Festschrift1 den Wandel des ursprünglichen Friedensdenkmals hin zu einem Mahnmal des Gedenkens an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Mit der Erinnerung an die einstigen Ursprünge (Friedensdenkmal) und der architektonischen Änderung durch den Wiederaufbau in den sechziger Jahren (Mahnmal) werden von Fachhistorikern nun Unterschiede hervorgehoben, die zu der öffentlichen Frage Anlass gegeben haben, ob nicht ein angemessener oder würdigerer Umgang mit dem Friedensdenkmal auf dem gleichnamigen Friedensplatz wäre, wenn seine ursprüngliche Form wieder rekonstruiert würde.
Im Vortrag wurde unter anderem auf den profanen Bierausschank rund um den Sockel des Friedensdenkmals hingewiesen. Im Text wird aber auch „das Gedenken an den Holocaust“ kritisch erwähnt, dort heißt es: „Selbst der gut gemeinte Brauch, am 9. November einen Kranz zum Gedenken an den Holocaust zu Füßen des Denkmals zu legen, folgt dabei noch den Spuren des Nationalsozialismus; denn niemals wäre dem Stifter und Künstler in den Sinn gekommen, aus einem nationalen Symbol ein Symbol der Trennung von Deutschen und Juden zu machen.“ (S.17)
Ursprung und Wandel der geschichtlichen Bedeutung werden hier in einer Weise gegenüber gestellt, dass sich grundsätzliche Fragen stellen: Wohin sollen solche Überlegungen zu „Ursprung“ und späterer Geschichte eigentlich führen? Welche Absichten und Interessen verbinden die Autoren selbst mit der Hervorhebung dieser Unterscheidung von „Stifterintention“ (1911) und späteren „Spuren des Nationalsozialismus“ (1965) und Holocaustgedenken der letzten Jahre, das sie noch dazu falsch datieren: nicht am 9. November, sondern am 27. Januar wird ein Kranz niedergelegt? Am 9. November wird zwar vielerorts an die Pogromnacht, dem Auftakt zum Holocaust, erinnert, in Steinheim jedoch seit 2007 am Morgen des 10. Novembers, dem Zeitpunkt der Zerstörung der neuen Steinheimer Synagoge.
Am 27. Januar, am Tag der Befreiung des Lagers Auschwitz 1945, wird umfassend der Opfer des Nationalsozialismus gedacht: die Lagerbefreiung ist ein Motiv der Hoffnung. Möglicherweise verbergen die Datierungsungereimtheiten auch unterschiedliche Geschichtsinterpretationen.
Das heutige „Mahnmal“ ist den ursprünglichen Motiven des Stifters des Friedensdenkmals dann möglicherweise viel näher als die „Bedeutungswandel“ Hypothese glauben machen möchte. Dies sei hiermit im Folgenden zur Diskussion gestellt:
1 Literaturverzeichnis am Ende, hier: vgl. E. Henke, N. Kemmerer und M. Maaser, Vom Denkmal zum Mahnmal, in: N. Kemmerer/M. Maaser (hg) im Auftrag des Heimat- und Geschichtsvereins Steinheim am Main e.V. : Friedensdenkmal – Geschichtsverein - Johannisfeuer , Festschrift 1911 – 2011, StJb 6, Hanau-Steinheim 2011, S.13-25)
Als Versammlungsort in der Altstadt hat der Friedensplatz gewiss eine wechselvolle Geschichte. Seit seiner Einweihung im Jahr 1911 war das Friedensdenkmal verschiedentlich genutzter Ort. Wohl auch die Parteigänger der Nationalsozialisten bevorzugten es für Versammlungszwecke. Im Jahr des Novemberpogroms und Synagogenbrände, 1938, wurde das Friedensdenkmal beschädigt und zwei Jahre später, 1940, zerstört und abgerissen. Erst in den sechziger Jahren wurde es wieder aufgestellt. Der Initiator war wieder ein
prominenter Steinheimer, der bereits an der Denkmalseinweihung zugegen war und selbst
1933 aus dem Staatsdienst entlassen wurde. Ein Denkmal, ein Ortsmittelpunkt mit einer sehr eigenen Geschichte.
Eigen waren wohl schon Planung und Einweihung: Stifter wie Künstler, beide seit Schulzeiten miteinander befreundet, inzwischen nach Mannheim und München verzogen und dort erfolgreich beruflich und künstlerisch tätig, sorgten mit Unterstützung lokalpolitisch prominenten Vertretern für die Aufstellung dieses Denkmals in ihrem Herkunftsort, ein ungewöhnliches Denkmal, das für ihre Zeit, dem Kaiserreich, seines gleichen suchen kann. Seine betont unmartialische und unheroische Darstellung und Symbolisierung war für die Kaiserzeit Wilhelms II. erstaunlich. So fand es wohl auch erst im zweiten Entwurf die behördliche Zustimmung zur Aufstellung: auf dem Sockel ein kindlich dargestellter Jüngling im antiken Stil, der einen Ölzweig in die Höhe reckt.
An diesen Ursprung erinnerte vor kurzem, im Oktober 2011, ein Vortrag von Dr. Maaser zum hundertjährigen Bestehen des Friedensdenkmals. In einem Beitrag in der Festschrift2 nehmen die drei Autoren Stellung zu der Geschichte. Unter dem Titel „Vom Denkmal zum Mahnmal“ halten sie kritisch fest, dass mit dem Neuaufbau in den sechziger Jahren eine Deutungsverschiebung der Symbolik des Denkmals vorgenommen wurde, die vom Stifter und Künstler so nicht intendiert war, und somit historisch und gedanklich nicht gedeckt ist:
Ludwig Meyer-Gerngross, geboren 1859 in Steinheim, später erfolgreicher Kaufmann in Mannheim, kaisertreuer und patriotischer Deutscher jüdischen Glaubens, stiftete 1911 zum vierzigsten Jahresgedenken der Gründung des Deutschen Reiches 1871 das Friedensdenkmal in der Hoffnung auf einen fortgesetzten dauerhaften „inneren und äußeren“ Frieden im deutschen Reich. Er stiftete gewiss kein Denkmal der friedlichen Völkerverständigung oder der Friedensbewegung, wie wir diese heute kennen.
Die Autoren sehen „nach den Erfahrungen des >Dritten Reiches<“ mit dem Wiederaufbau des Friedensdenkmals eine Verschiebung der Wahrnehmung – nicht mehr die ursprüngliche Idee steht im Vordergrund, sondern ein „jüdischer Erinnerungsort“, eben ein Mahnmal, so sähen es die Steinheimer heute (Festschrift, S.23). Was auch immer ein „jüdischer Erinnerungsort“ sein mag – Erinnerung an Juden? Von Juden? Wer erinnert sich wessen?
– der Hinweis darauf und der Gedanke, dass sich Bedeutungen und Wertungen von Denk-
Mälern vor immer neuer Geschichtserfahrung verändern, sind nachvollziehbar. Es ist bis zu einem gewissen Grad unausweichlich: keine Erinnerung, keine Erzählung, auch die der Geschichtswissenschaft nicht, bleibt über die Zeit dieselbe. An den Verschiebungen der Bedeutung werden mehr oder weniger „deutlich“ – oder eben: „verschlüsselt“, wenn man so möchte – die aktuellen Ansprüche, Auseinandersetzungen, Konflikte und Selbstverständnisse der in der Gegenwart Lebenden ablesbar und sichtbar.
Eine Frage bleibt: warum ist die Bedeutungsverschiebung für die Autoren so entscheidend? Bzw., in welcher Hinsicht, in welchem Kontext ist sie es? Was ist die Intention der Autoren in der heutigen Gegenwart mit ihrem Beitrag, mit Blick auf welches Publikum
----------------------
2S. Fußnote 1
und welche Leserschaft? Darüber geben die drei Fachhistoriker weniger Auskunft, sie geben sich zurückhaltend in der Bewertung. Eine zweite Frage schließt sich an: könnte der Bedeutungswechsel nicht viel mehr einer „Verschiebung“ gleichkommen, die zwar andere Akzente setzt, und dennoch im Kern eine Kontinuität und Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Friedensdenkmal aufweist? Hier scheinen die Autoren auf starker Abgrenzung zu bestehen: Der Stifter habe 1911 nichts im Sinn gehabt, was den später Lebenden einfallen konnte, nach den „Erfahrungen mit dem >Dritten Reich>“.
Hier setzen die Zweifel und damit das Nachdenken ein. Denn es gibt eine Kontinuität der Erfahrung – nämlich die des antisemitischen Vorurteils, der antisemitischen Agitation und antisemitischen Aktion – beginnend mit dem Kaiserreich, durch den Ersten Weltkrieg über die Weimarer Republik in den Nationalsozialismus hinein (und auch darüber hinaus). Antisemitismus ist keine nationalsozialistische „Erfindung“ und war und ist
„eine Erfahrung“, die Juden zu spüren bekamen und bekommen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies ein unterschätzter Deutungszusammenhang zwischen den Entstehungsmotiven des Stifters und dem wieder aufgestellten Friedensdenkmals ist, also dem Ort der Erinnerung, an dem wir uns versammeln.
An dieser Stelle sei der Text „Vom Denkmal zum Mahnmal“ im Zusammenhang wiedergegeben, weil er die zentrale Argumentation der Autoren ausführt, welche Anlass zum Nachdenken ist und zum Widerspruch reizt3:
Das Denkmal wurde also nicht etwa zum Gedenken an einen deutsch- oder christlich- jüdische Gemeinschaft oder Zusammengehörigkeit gestiftet, was niemandem in Steinheim in den Sinn kam, sondern allein als Hoffnung auf einen Frieden in Deutschland. Vielleicht stand der Gedanke Pate, dass es zu einem inneren Frieden kommen möge, wie er in Steinheim längst gelebt wurde. Aber niemals wurde dieses Denkmal für den Frieden zwischen Deutschen oder Christen und Juden verstanden.
Ein solcher Gegensatz wurde erst durch den Nationalsozialismus mit seinem Rassismus und Judenhass gelegt und hat seine Auswirkungen bis heute. Selbst der gut gemeinte Brauch, am 09. November einen Kranz zum Gedenken an den Holocaust zu Füßen des Denkmals zu legen, folgt dabei noch den Spuren des Nationalsozialismus; denn niemals wäre dem Stifter und Künstler in den Sinn gekommen, aus einem nationalen Symbol ein Symbol der Trennung von Deutschen und Juden zu machen.
Aber ebenso wenig darf dieses Denkmal als ein universales Mahnmal angesehen werden, das die Völker zum Frieden mahnt. Es galt den Menschen damals allein als ein nationales Symbol der Einheit der Deutschen unter einer Verfassung und dem Schutz durch die Ar-
mee, die letztlich den Raum bildeten, in dem Wohlstand und Glück in vereinter Kraft von
Bauern und Handwerkern, Landwirtschaft und Industrie gedeihen konnten.“ (Hervorhebung durch den Autor,T.K.)
In drei Absätzen nehmen die Autoren drei Anläufe, die Gründe des Denkmalsstifters von den späteren Denkmal-Nutzern scharf zu unterscheiden: „niemals“ wäre er auf diese oder jene Idee gekommen, wiederholt es sich im Text. In Steinheim wurde damals „der Frieden längst gelebt“, - eine Behauptung, der man gerne Glauben schenken würde, wofür die Historiker leider in dem Artikel keine Belege erbringen. Und: ein „nationales Symbol der Trennung von Deutschen und Juden“ ist als Gedanke in der Tat sehr abwegig. Im Ganzen wird den Lesern nahegelegt, auf jeden Fall davon auszugehen, dass die Erfahrungen des Antisemitismus gar keine Rolle gespielt haben könnten. Die Autoren nehmen den Begriff
„Antisemitismus“ in ihrem Text kein einziges Mal auf – obwohl der Begriff in der Zeit der
--------------------------------------------------
3 Henke/Kemmerer/Maaser, a.a.O., S. 16f.
Reichsgründung und des Kaiserreichs geprägt wurde und ganz selbstverständlich von Antisemiten wie Nicht-Antisemiten ausgesprochen wurde. Die Peinlichkeit, ihn zu verwenden, entstand ebenfalls erst viel später.
Dass aber „erst durch den Nationalsozialismus mit seinem Rassismus und Judenhass“ ein Gegensatz von Juden und Deutschen konstruiert wurde, muss entschieden widersprochen werden. Rassismus und Judenhass waren zentrale Gedanken und Praxen vom einfachen Vorurteil des Einzelnen über weltanschauliche Vereinsbildungen bis zu diskriminierenden Aktionen in der Öffentlichkeit, - Erfahrungen gerade im Kaiserreich, denen sich keine Jüdin und kein Jude entziehen konnte. Der Antisemitismus in der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft war eine Begleiterscheinung des Nationalismus nach der Reichsgründung und ging einher mit den Emanzipationsgesetzen, die im Kaiserreich durchgesetzt worden waren. Der Antisemitismus in Theorie und Praxis, in Gedanke und Aktion, in Vorurteil
und Organisation von Vereinen und Parteien war nicht immer und überall gleich stark ausgeprägt, er unterlag in den Jahren „Konjunkturen“.
Auch in Steinheim. Hinweise auf lokale Erfahrungen finden sich in den Erlebnisberichten und Kommentaren in jüdischen Wochenzeitungen aus den Jahren 1891 und 18954 (beide sind am Ende dieses Textes vollständig zitiert). Für das Jahr 1911 mögen hier zwei Zeitungsartikel genügen – die vielleicht nicht die persönliche Auffassungen, etwa von Ludwig Meyer-Gerngross vollständig treffen, aber allemal typische Erfahrungen und Stimmungen von Deutschen jüdischen Glaubens zur damaligen Zeit wiedergeben und die ihm sicherlich nicht fremd waren:
Am 27. Januar wird in Deutschland und allerorten, wo Deutsche wohnen, des K a i s e r s G e b u r t s t a g festlich begangen. Unter den Glückwünschenden befinden sich die Juden wie alle übrigen Deutschen, wes Glaubens sie auch sind. Zwar unter den persönlichen Gratulanten sieht man sie nicht und auch nicht an der Prunktafel, die der Deutsche Kaiser gibt. Aber nicht, weil sie sich ausschließen, sondern weil sie von den höchsten Aemtern ausgeschlossen sind. Während in Italien und Frankreich, in England und der Türkei Juden ihren Platz unter den hohen Beamten des Zivils und Militärs einnehmen, haben die deutschen Juden, die an Kultur und Wissen, an Bildung und Reichtum hinter denen anderer Länder wahrlich nicht zurückstehen, keinen Platz unter den Hohen der Erde. Und doch haben sie sich um das Reich recht wohl verdient gemacht und auch um den Kaiser. Als aus des Kaisers eigenster Initiative der fruchtbare Gedanke zur Tat wurde, Forschungsinstitute für die Wissenschaft bei Gelegenheit der Zentenarfeier der Berliner Universität einzurichten, haben deutsche Juden höchst stattliche Summen beigesteuert. Sie taten es nicht oder nur ausnahmsweise in Hoffnung auf Titel und Orden, sie lieferten die großen Summen nicht immer aus reiner Liebe zur Wissenschaft, sondern sie gaben sie eben auch aus Liebe zum Kaiser. Se knüpften, was ihnen wohl angestanden hätte, keine Bedingung an ihre Spende. Wir glauben und hoffen noch immer, daß nicht der Kaiser es ist, von dem die ungleiche Behandlung der Juden ausgeht. (…) Und so ist unser Wunsch zum Geburtstag des hohen Herrschers ein Appell von dem nicht genügend Unterrichteten an den besser zu Unterrichtenden; der Wunsch, daß der Monarch, der nach Gerechtigkeit strebt, auch Gerechtigkeit spende d e r Glaubensgemeinschaft, deren Söhne mit Aufopferung ihrer ganzen Kraft wirken und arbeiten für das Heil des Vaterlandes und hin den anderen Bürgern des Deutschen Reiches nicht zurückstehen in dem Gefühle der Ehrfurcht und Liebe für den Herrscher des herrlichen Deutschen Reichs.5
Am Ende des Jahres 1911 zieht die gleiche Zeitung in der gleichen Rubrik Bilanz:
Das Jahr 1911 neigt sich seinem Ende zu. Wir haben keinen Anlaß, ihm eine Träne nachzuweinen. Die Verhältnisse unserer Glaubensbrüder im Osten haben sich eher verschlimmert, die in Deutschland nicht gebessert. (…) In Deutschland ist vonseiten der Juden wacker gearbeitet worden. Wenn auch vielfach der Unken-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4Die beiden Zeitungsmeldungen aus den Jahren 1891 und 1895 finden sich im Anhang zum Text wiedergegeben.
5Vgl. Allgemeine Zeitung des Judentums. Ein unparteiisches Organ für alles jüdische Interesse, Heft 4 vom 27.1.1911,
75. Jg., Rubrik: Die Woche, S. 40), Fundstelle ebenfalls im Anhang
ruf von einem „Untergang der Juden“ erscholl, wenn auch antisemitische Anrempeleien sich zeigten, böse Angriffe laut wurden, wenn auch (…der Satz erinnert noch einmal an internationale Erfahrungen). Wir dürfen sagen: wir haben gelebt. Und dem redlichen Kampfe ist noch immer der Sieg geworden.6
Es mag ja nun auch durchaus so sein, dass es in diesen Jahren von 1911 um den „inneren Frieden“ zwischen jüdischen und nicht-jüdischen deutschen Bewohnern in Steinheim ganz gut bestellt war und öffentlich negative Vorfälle sich in Grenzen hielten. Gewiss fühlte sich der Denkmal-Stifter Meyer-Gerngross wohl und willkommen in Steinheim. So stiftete er
1911 ja auch nicht nur das Friedensdenkmal, wurde zur Gründung des Heimat- und Ver-
kehrsvereins eingeladen, dem Vorläufer des Geschichtsvereins, sondern er stiftete ja auch eine erhebliche Summe Geld, die den bedürftigen Teilen der Bevölkerung Steinheims zu gute kommen sollte. Die Verteilung des Geldes sollte gemeinsam von den Gemeindevorstehern der drei Religionen ohne Bevorzugung einer Glaubensrichtung vorgenommen werden.
Aber allein das „erfahrene Glück in der Heimatstadt“ als Anlass für die Großzügigkeit zu interpretieren, erscheint doch eine Idealisierung indem es eben auch die damaligen negativen Erfahrungen der antisemitischen Angriffe ausblendet. Private Freundschaften und Familienglück mögen Menschen positiv ermutigen, wohltätige Stiftungsvorhaben umsetzen zu wollen und mit anderen zusammen dann auch zu können – eben gerade auch angesichts eines gesellschaftlichen Gegenwinds mit vielen alltäglichen negativen Erfahrungen. Private Freundschaft und Familienglück können aber kein Modell für gesellschaftliche Verallgemeinerung liefern, sie verweisen nur auf die Sehnsucht nach anderen Erfahrungen der Gleichberechtigung, die in der Gesellschaft zum Teil hasserfüllt verwehrt werden.
Die ausgiebige öffentliche Stiftungs- und Spendenerfahrung, so wie es der Kommentar zum Kaisergeburtstag deutlich äußert, ist doch vor allem auch der leidvollen Erfahrung von patriotischen Deutschen jüdischen Glaubens geschuldet, die auf der Suche nach ge-
sellschaftlicher Anerkennung waren. Geht doch die demonstrative Großzügigkeit von deutschen Juden gerade in die Richtung, das Gemeinwesen im Kaiserreich dahingehend zu fördern, dass Emanzipation und Anerkennung der jüdischen Bevölkerung als gleichwertige Bürger endlich verwirklicht werden, so wie es den vorhandenen und bestehenden Gesetzen entsprechend wäre. Dafür „kämpften“ Juden unter Einsatz der Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen.
Ludwig Meyer-Gerngross war vermögend und als Kaufmann erfolgreich, und wollte dies auch nicht verstecken. Er nahm in Mannheim öffentliche Aufgaben im Synagogenvorstand und in der Industrie- und Handelskammer wahr (später als 1911), er war verheiratet und hatte zwei Söhne. Der ältere Sohn Max, geb. 21.11.1892 in Mannheim, fiel als Gefreiter am
12.05.1917, der jüngere Fritz, geb. 16.1.1894 in Mannheim, fiel als Unteroffizier am
25.10.1918 ebenfalls im Ersten Weltkrieg. Viel später, im Todesjahr von Meyer-Gerngross,
1932, erinnerte der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten mit einem Gedenkbuch an die Gefallenen, in dessen Vorwort von Dr. Leo Löwenstein der Rechtfertigungsdruck auf die deutschen Juden massiv angesprochen wird:
Das edelste deutsche Blut ist das, welches von deutschen Soldaten für Deutschland vergossen wurde. Zu diesen gehören auch die 12.000 Gefallenen der deutschen Judenheit, die damit wiederum ihre allein ernsthafte und achtunggebietende Blutprobe im deutschen Sinne bestanden hat.7
6Vgl. Allgemeine Zeitung des Judentums Heft 52, vom 29.12.1911, S. 614
7Vgl. Onlineprojekt Gefallenendenkmäler, www.denkmalprojekt.org/verlustlisten/rjf_wk1.htm
Der Höhepunkt der antisemitischen Parteien im Kaiserreich war Ende des 19. Jahrhunderts überschritten. Nach der Jahrhundertwende war der Antisemitismus eine Angelegenheit im gesellschaftlichen Alltag von Vereinen und Berufsgruppen. Die Reichstagswahl
1912 wurde als „Judenwahl“ bezeichnet – eine Verschiebung „nach links“ wurde der öffent-
lichen Einflussnahme der jüdischen Wahlberechtigten zugeschrieben: 1911 gab es in allen jüdischen Zeitungen einen Wahlaufruf nach dem Motto: „Hauptsache gegen die Antisemiten!“ In der Mitte des Ersten Weltkriegs wurden in der Bevölkerung hetzende Zweifel laut, ob denn wirklich die Juden sich nicht vor dem Fronterlebnis drückten. Die Heeresleitung sah sich daraufhin zu einer „Judenzählung“ veranlasst, deren Ergebnisse allerdings nie veröffentlicht wurden.
Einmal von dem persönlich schmerzlichen Verlust seiner im Krieg gefallenen Söhne, ist es doch fortgesetzt ganz unwahrscheinlich, dass Ludwig Meyer-Gerngross den Schmerz und das Leid der antisemitischen Hetze nicht gespürt, nicht gesehen oder nicht erlitten haben sollte.
Er initiierte nach dem Ersten Weltkrieg eine Stiftung für die Bedürftigen in Steinheim, außerdem setzte er, genauso wie 1911, eine einmalige Summe aus. Fortgesetzt und konstant sollte Hilfe vor Ort geleistet werden können. Bis Ende der 20ziger Jahre gab er weitere zusätzliche Summen für den Stiftungszweck. Als er 1932 starb, beabsichtigte seine Witwe die Stiftungstätigkeit zunächst fortzusetzen.
Im Jahr 1940 wurde Helene Meyer-Gerngross, geborene Dinkelspiel, inzwischen 74-jährig in einem Eisenbahntransport mit 2333 anderen Mannheimerinnen und Mannheimern in das französische Lager Gurs deportiert. Die Überlebensbedingungen galten als sehr schlecht, täglich starben 6 Menschen. Helene Meyer-Gerngross verstarb im Lager Gurs noch im gleichen Jahr 1940.
Mit dem Tod der Ehefrau von Ludwig Meyer-Gerngross endet unserer Kenntnis nach das Leben des letzten unmittelbaren Familienmitgliedes. 1940 wurde auch sein gestiftetes Denkmal zerstört. Auf dem historischen Weg vom Friedensdenkmal zum Mahnmal mag die Bedeutung sich gewandelt haben, eine Intention des Stifters allerdings ist konserviert, sie erscheint den nachgeborenen Generationen unübersehbar aktuell: Die Hoffnung auf einen „inneren Frieden“ in der Gesellschaft bezüglich des Zusammenlebens untereinander kommt dem Denkmal von 1911 sehr nahe.
Die Kranzniederlegung findet nicht, wie im Aufsatz der drei Historiker zu lesen, und sie fand nie am 09.11. statt, sondern am 27.01. Der Datumsfehler mag noch einem Druckfehler gleichkommen. Eben nicht die Pogromnacht als Auftakt zum Holocaust wird zum Ausgangspunkt von Nachdenken, sondern auf den Tag der Befreiung des Lagers Auschwitz ist der Gedenktag gelegt (27.1.1945). Die Kranzniederlegung aber als „Brauch“ zu bezeichnen, ist mehr als problematisch. Sie trifft ins Mark des Verständnisses des Holocaustgedenkens selbst. Denn Brauchtum ist ein veralteter Begriff für eine ritualisierte und traditionelle Handlungsweise eines gesellschaftlichen Gemeinwesens. So „volkstümlich“ und mit entsprechend langer Tradition ist das Holocaustgedenken aber gerade nicht. Seit 1996 auf Proklamation des damaligen Bundespräsidenten ist es ein Anliegen, das von den politisch verfassten Gremien getragen wird – der Gedenktag wird in großen Städten und in Parlamenten begangen, 2005 wurde er internationaler Gedenktag durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Auch in der Art der Gestaltung ist es gerade kein „Brauch“, sondern nach wie vor Aufruf zum öffentlichen Denken über Dinge, die allzu leicht in Vergessenheit geraten, weil sie unangenehm waren und deshalb dem Schweigen vor allem aber auch der Fehlinterpretation ausgesetzt sind.
Anhang:
Anmerkung 4 weist auf zwei Zeitungsabschnitte hin. Sie werden im Folgenden wiedergegeben. Beide entstammen der Wochenzeitschrift „Der Israelit. Ein Centralorgan für das orthodoxe Judentums“, die seit 1860 bis zum Verbot im Herbst 1938 erschien, sie war das bedeutendste Publikationsorgan der deutsch-jüdischen Orthodoxie, durchaus im bewussten Gegensatz zum liberal-reformerischen „Allgemeinen Zeitung des Judentums“, Anmerkung 5 und 6 weisen die Textstellen/Zitate aus. Alle Zeitungen vollständig finden sich vollständig digitalisiert in www.compactmemory.de
1891:
Offenbach, 26. Juni. Das hiesige Schöffengericht hatte sich in seiner heutigen Sitzung mit einer Beleidigungsklage zu befassen, die einen antisemitischen Untergrund hat. Angeklagt sind die Gastwirth Baier Eheleute in Groß-Steinheim, welche um die Fastenzeit einen Wagen durch verschiedene Straßen des Ortes fahren ließen, auf welchem sich zwei aufgeputzte Puppen befanden, die einen dortigen israelitischen Einwohner und dessen Schwiegermutter darstellen sollten. Dabei befand sich ein Plakat mit den Worten „Der Galgen den Wucherern“. Die beiden Israeliten fühlten sich beleidigt und stellten Strafantrag. Die Staatsanwaltschaft nahm, wie dies bei antisemitischen Hetzereien jetzt im Großherzogtum Hessen immer geschehen wird, das Vorhandensein des öffentlichen Interesses an und erhob öffentliche Klage. Die Verhandlung dauerte mehrere Stunden und endete mit Verurtheilung der beiden Angeklagten in einer Geldstrafe von je 60 Mark und in die nicht unbedeutenden Kosten.
„Der Israelit“, Heft 54, 32. Jg., vom 09.07.1891, 2. Beilage S.1011, Rubrik: Zeitungsnachrichten und Correspondenzen: Deutschland
1895:
Groß-Steinheim i.H. Vor einigen Jahren noch herrschte hier das roheste Treiben der Antisemiten. Böckel und Genossen wurden mit Jubel begrüßt und durften ihre Hetzreden und Schmähungen gegen die Juden ungehindert an den Tag bringen. In der Hochflut dieses empörenden Treibens bildete sich der hiesige Antisemitische Verein, dessen Devise: „Kauft nicht bei Juden und verkehrt nicht mit ihnen“ war. Die Schreier und Hetzer machten bei dieser Gelegenheit, wie überall, auch hier die besten Geschäfte. Die verhetzten Bewohner unserer Gegend sahen aber bald ein, daß es doch nicht so gut ohne die Juden gehen wollte. Nach und nach lüftete sich der Schleier vor den Verblendeten und am Sonntag den 20 v. M. löste sich der Verein, welcher nur noch aus einigen interessirten Mitgliedern bestand, ganz auf. Daß das Ansehen der hiesigen Juden durch obiges Treiben nicht gelitten, zeigte am besten, das an demselben Sonntag stattgehabte Concert der Schüler unseres Lehrers Herrn Falkenstein, welches sich der regsten Theilnahme auch von Seiten unserer christl. Mitbürger erfreute. Das Concert, welches zum Besten des neubegründeten Synagogenchores veranstaltet, trug dem Leiter desselben Herrn Falkenstein großes Lob ein. Auch am letzten Geburtstage Sr. Majestät unseres Kaisers war es unserm allverehrten Herrn Lehrer Falkenstein beschieden, beim Festaktus des hiesigen Turnvereins, die Festrede mit dem Toaste auf den Kaiser vorzutragen. So haben sich hier die Ansichten geändert und zum Guten und Wahren gewendet. Möchten doch alle Verführten, von schamlosen Schreiern Verhetzten, wie hier, so überall bald zur besseren Einsicht gelangen. Möchten aber auch unsere Glaubensgenossen auf dem Lande doppelt auf ihrer Hut sein, nichts zu vollführen, was öffentliches Ärgernis erregt und Juden in den Augen ihrer andersgläubigen Mitbürger verächtlich machen kann.
„Der Israelit“ Heft 13 vom 14.02.1895; 36. Jg. 2. Beilage ,Beilage, S. 257-258, Rubrik: Vermischtes
Verwendete LITERATUR:
E. Henke, N. Kemmerer und M. Maaser, Vom Denkmal zum Mahnmal, in: Steinheimer Jahrbuch für Geschichte und Kultur, Band 6, herausgegeben von Norbert Kemmerer und Michael Maaser im Auftrag des Heimat und Geschichtsvereins Steinheim am Main e.V.: Friedendsdenkmal – Geschichtsverein – Johannisfeuer, Festschrift 1911 – 2011, S.13-
25
Ernst Henke, Geschichte der Juden der Stadt Steinheim am Main, Hanau-Steinheim
2003
Leo Mayer, Die jüdische Gemeinde von Steinheim am Main – mit den Orten Klein- Auheim, Hainstadt und Dietesheim, 2007
Herangezogen:
Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II ,II, Machtstaat vor der
Demokratie, München 2. Auflage, 1993
Volker Ulrich, Die nervöse Großmacht. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs 1871-1918, Frankfurt am Main 1997
Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historischen Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 1, Studienausgabe 1. Aufl. 2004 mit beigefügter Korrigenda, Stuttgart (1972), Stichwort: Antisemitismus, S.129-153
Außerdem:
Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, Gedenkbuch:
http://denkmalprojekt.org/Verlustlisten/rjf_wk1
Internierungslager Gurs, Frankreich, die Internierungslisten finden sich unter:
http://gurs.free.fr/
eine Abbildung des Familiengrabes der Familie Mayer-Gerngross auf dem Mannheimer jüdischen Friedhof findet sich unter:
http://www.alemannia-judaica.de
Digitalisierungsprojekt jüdischer Periodika:
www.compactmemory.de